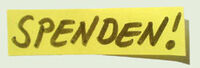In ihrem 86-seitigen Entwurf argumentieren die Gentechnikexpert:innen ähnlich wie schon bei der Risikobewertung von NGT-Pflanzen. Solange kein fremdes gentechnisches Material eingeführt, sondern nur einzelne Gene im Erbgut geändert würden, gebe es auch keine neuen Risiken. Sollten die NGT in solchen Fällen am falschen Ort Gene ändern, seien solche Off-Target-Effekte mit den Folgen konventioneller Züchtung vergleichbar, heißt es in dem Gutachten. Die Risken bei großflächigen Änderungen im Erbgut oder beim Einschleusen fremder Gene (als SDN-3-Verfahren bezeichnet) seien mit den Risiken der klassischen Gentechnik vergleichbar und daher auch nicht neu. Daraus folgerte das Gentechnik-Panel der EFSA, dass seine in den Jahren 2012 und 2013 herausgegebenen Leitlinien für die Risikobewertung von Gentechnik bei Nutztieren die Basis für künftige Risikobewertung sein könnten. Allerdings würden die Leitlinien manche Aspekte wie Tierwohl und Tiergesundheit nur teilweise behandeln, so dass Aktualisierung erforderlich sein könnten. Gentechnisch veränderte Versuchstiere für die medizinische Forschung und die Anwendung von Gene Drives als Vererbungsturbo waren nicht Gegenstand der Gutachtens.
Die gentechnikkritische Organisation Testbiotech sieht ebenfalls Bedarf für eine Anpassung der bestehenden Prüfrichtlinien, hält den Ansatz der EFSA aber für verfehlt. Sie kritisiert, dass die Behörde gar nicht definiere, was sie denn unter "neuen Risiken" verstehe. Für eine solche Definition hätte sich die EFSA „zunächst eingehend mit den Unterschieden zwischen bisheriger Züchtung und neuer Gentechnik befassen müssen“, schrieb Testbiotech. Doch eine solche Analyse fehle im Bericht. Aufgrund dieser falschen Herangehensweise gebe das EFSA-Gutachten den aktuellen Stand des Wissens nicht korrekt wieder. „Eine Fülle von Publikationen zeigt, dass bei NGT-Anwendungen an Tieren im Vergleich mit der konventionellen Züchtung sowohl mit spezifischen Risiken als auch mit zusätzlichem Tierleid zu rechnen ist“, heißt es in der Mitteilung von Testbiotech. Denn während Pflanzen eine relativ hohe Toleranzschwelle für Mutationen haben könnten, gelte dies bei Tieren nicht. Kleine Veränderungen könnten schwere Krankheiten wie Krebs auslösen. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit für eine umfassende Regulierung von NGT-Tieren. Testbiotech thematisierte auch die Zusammensetzung des Gentechnik-Panels der EFSA. Dieses sei „viel zu wenig unabhängig von den Interessen von NGT-AnwenderInnen und der dahinterstehenden Industrie“. Zudem habe die EFSA die maßgebliche Vorarbeit für ihr Gutachten an eine Expertin vergeben, die selbst an Patentanträgen auf NGT-Tiere beteiligt sei.
Den Auftrag für ihr Gutachten hatte die EFSA bereits 2018 von der EU-Kommission erhalten, damals zusammen mit Bewertungsanfragen für NGT-Pflanzen und NGT-Mikroorganismen. Da diese beiden für die Kommission vorrangig waren, kamen die NGT-Tiere erst als Drittes an die Reihe. Hinzu kam, dass gentechnische Anwendungen bei Tieren nach zahlreichen Rückschlägen in der klassischen Gentechnik lange Zeit kein Thema für die Politik mehr waren. Allerdings zeigte die von Testbiotech genannte Übersicht, die sich die EFSA 2023 von der US-Tiergentechnikerin Alison L. Van Eenennaam erstellen ließ, dass mehrere NGT-Tiere inzwischen in Amerika oder Japan zugelassen sind oder demnächst auf den Markt kommen sollen. Das gilt etwa für hornlose Rinder, Rinder mit kurzem Fell oder besonders viel Fleisch sowie schnell wachsende Fische und virusresistente Schweine. Insgesamt listet die Übersichtsarbeit Studien zu 195 verschiedenen Anwendungen auf. Davon betrafen 59 Prozent Säugetiere, 29 Prozent Fische, acht Prozent Vögel und vier Prozent Insekten. Fast ein Drittel der Studien befasste sich mit Erbguteingriffen, die den Ertrag an Fleisch, Milch oder Seidenfaser erhöhen sollen. In gut einem Fünftel der Arbeiten stand die Fortpflanzung im Mittelpunkt, oft mit dem Ziel, nur weibliche oder männliche Nachkommen zu erzielen. Ein Sechstel der Arbeiten entfiel auf Resistenzen gegen Krankheitserreger. Allergenarme Erzeugnisse, eine geänderte Fleisch- oder Milchqualität oder das Erscheinungsbild der Tiere waren weitere Forschungsziele. Zugelassen werden müssten solche NGT-Tiere derzeit nach dem geltenden EU-Gentechnikrecht, auch für den Import als Lebensmittel. Anträge dafür liegen aktuell keine vor. Der derzeit diskutierte Vorschlag der EU-Kommission, das Gentechnikrecht für NGT zu deregulieren, gilt nur für Pflanzen. [lf]