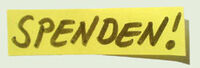Das Schweizer Parlament hatte den Bundesrat beauftragt, eine Vorlage für eine risikobasierte Zulassungsregelung für Pflanzen aus neuen Züchtungstechnologien auszuarbeiten. Der Bundesrat wählte dafür – wie auch die EU-Kommission – den Weg eines Spezialgesetzes, das diese Pflanzen aus dem bestehenden Gentechnikgesetz ausnimmt. Allerdings unterscheidet sich der Schweizer Entwurf in wesentlichen Punkten von dem der EU-Kommission. Es gibt weiterhin für diese Pflanzen eine Risikobewertung; sie müssen durchgehend gekennzeichnet werden und Koexistenzmaßnahmen sollen die gentechnikfreie Landwirtschaft absichern.
Der Schweizer Gesetzentwurf umfasst alle „Pflanzen, deren Erbmaterial mit neuen Züchtungstechnologien verändert wurde und die kein transgenes Erbmaterial enthalten“. Als neue Züchtungstechnologien definiert der Entwurf „gentechnische Verfahren der gezielten Mutagenese und der gezielten Cisgenese“. Das entspricht in etwa der EU-Definition der neuen gentechnischen Verfahren (NGT). Jedoch unterteilt die Schweizer Regierung diese NGT-Pflanzen nicht (wie die EU-Regelung) in zwei Kategorien. Sie halte eine solche Unterscheidung für „nicht sachgerecht“, da „die Risiken nicht direkt mit der Anzahl oder der Grösse der gentechnischen Veränderungen zusammenhängen“, schreibt die Regierung in der Gesetzesbegründung.
Zwar will auch der Schweizer Bundesrat mit seinem Entwurf „der Bedeutung neuer Züchtungstechnologien und der wissenschaftlichen Forschung in diesem Bereich für eine nachhaltige Produktion Rechnung tragen“. Allerdings soll der Entwurf „die Gesundheit und die Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt ebenso schützen wie die gentechnikfreie Produktion. Er soll die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens dauerhaft erhalten und den Konsument*innen Wahlfreiheit ermöglichen. Um das zu erreichen, müssen auch alle NGT-Pflanzen für Feldversuche und später für das Inverkehrbringen ein Bewilligungsverfahren mit einer Risikobeurteilung durchlaufen. Dabei legt der Gesetzentwurf den Rahmen und die zu betrachtenden Schutzgüter fest. Die Begründung verweist auf entsprechende Regeln im Gentechnikgesetz oder einschlägigen Verordnungen. Keine Bewillingung brauchen NGT-Pflanzen, wenn bereits eine artgleiche Pflanze zugelassen wurde, „deren biologische Eigenschaften und gentechnische Veränderungen vergleichbar sind“. Als Beispiel nennt die Begründung verschiedene Kartoffelsorten, bei denen jeweils die gleichen Gene ausgeschaltet wurden, um eine Resistenz gegen Krautfäule zu erreichen.
Wer NGT-Pflanzen in Verkehr bringt, braucht nicht nur eine Bewilligung dafür, sondern „muss insbesondere die angemessene Sorgfalt walten lassen, um unerwünschte Vermischungen mit Pflanzen aus herkömmlicher Züchtung zu vermeiden (Trennung des Warenflusses).“ Die Begründung stellt klar, dass dies für die gesamte Wertschöpfungskette gilt und „alle verhältnismässigen Massnahmen“ umfasst. Zudem muss derjenige, der NGT-Pflanzen anbaut, „hinreichende Mindestabstände“ zu Flächen einhalten, auf denen Pflanzen aus herkömmlicher Züchtung angebaut werden. Die Details dazu soll die Regierung regeln.
Gekennzeichnet werden müssen NGT-Pflanzen nach dem Schweizer Entwurf mit den Worten „aus neuen Züchtungstechnologien“ oder „aus neuen genomischen Verfahren“. Es soll einen Schwellenwert für unabsichtliche Verunreinigungen geben und die Kennzeichnung soll sich durch die ganze Lebensmittelkette ziehen. Die Details dazu soll ebenfalls der Bundesrat regeln. Allerdings sieht der Entwurf eine Ausnahme vor: Bei fehlenden Nachweismethoden kann der Bundesrat die Kennzeichnung anders gestalten oder ganz darauf verzichten.
Das ist eine der Ausnahmen, die die Schweizer Allianz Gentechfrei (SAG) meint, wenn sie schreibt, der Gesetzentwurf enthalte „gefährliche Schlupflöcher, u.a. in der Risikoprüfung, die Spielraum für willkürlichen Interpretationen lassen“. Ihr missfällt vor allem die Bestimmung, wonach eine Risikobewertung entfällt, wenn bei der gleichen Art bereits eine vergleichbare gentechnische Veränderung vorgenommen wurde. „Eine solche Vergleichbarkeit ist wissenschaftlich nicht haltbar, da jeder gentechnische Eingriff neue Risiken birgt“, argumentiert die SAG. Ein blosser Vergleich des Endproduktes – ohne Berücksichtigung des Prozesses, der dazu geführt hat – reiche nicht aus, um den Schutz von Mensch, Tier und Umwelt zu gewährleisten. Die SAG kritisiert auch, dass die Details der Koexistenzmaßnahmen offen bleiben. „Im schlimmsten Fall werden sie ohne parlamentarische Debatte auf Verordnungsstufe geregelt“.
Für Martin Graf, Präsident des Vereins für gentechnikfreie Lebensmittel, ist der vorgelegte Entwurf ein Etikettenschwindel: „Der Bundesrat hat auf Druck der Gentechnik-Lobby das Wort Gentechnik aus dem Gesetz und bei der Kennzeichnung von Produkten gestrichen“. Damit führe er die Bevölkerung hinters Licht. Graf kritisierte auch, dass der Bundesrat das Problem der Patentierung von NGT-Pflanzen nicht aufgriff. „Der Gesetzesentwurf ignoriert zentrale Patentfragen und liefert Schweizer Züchter und Bäuerinnen der wachsenden Abhängigkeit von Agrarmultis aus“, sagte Graf.
Bis zum 9. Juli 2025 können Interessierte nun zu diesem Gesetzentwurf Stellung beziehen. Vernehmlassung heißt diese öffentliche Konsultation im Schweizer Gesetzgebungsverfahren. Anschließend überarbeitet der Bundesrat seinen Entwurf und leitet die endgültige Fassung dann dem Parlament zu. Angedacht ist das für das erste Quartal 2026. Parallel dazu treibt der Verein für gentechnikfreie Lebensmittel seine Lebensmittelschutz-Initiative für eine Volksabstimmung voran. Er fordert darin strikte Regeln für den Einsatz von NGT in der Schweizer Landwirtschaft. Bis Anfang März 2026 müssen die für eine Volksinitiative notwendigen 100.000 Unterschriften vorliegen. Sollte das gelingen, kann es in der Schweiz 2026 oder 2027 zu einer Volksabstimmung über den zukünftigen Umgang mit NGT in der Landwirtschaft kommen. [lf]